Friederike Walter
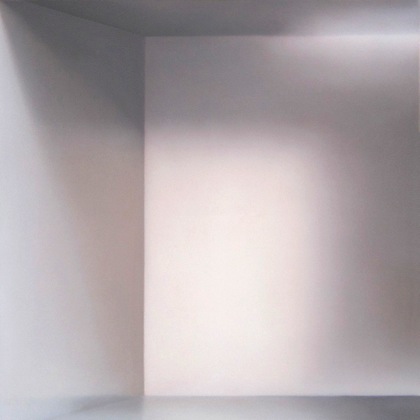
… im Gespräch
„Meine Bilder schreien dich nicht an. Sie brauchen eindeutig Zeit, bis sie anfangen, ihre Fragen zu stellen“, so sagt Friederike Walter im Interview. Die Künstlerin baut, zeichnet und malt Räume. Damit hat sie bereits während ihres Studiums an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach begonnen. Der Tradition des modernen Flaneurs verpflichtet, findet sie ihre Motive im Stadtraum vor oder erfindet sie im Gedankenspiel neu. Sei es, dass uns die Künstlerin Einblicke in scheinbar private Zimmer gewährt oder ohne helfenden Erzählfaden durch anonym dargestellte Räume irren lässt, ihre zunehmend abstrakter werdenden Bilder sind das, was der amerikanische Kunstkritiker Michael Fried¹ einst über die Werke der Minimal Art schrieb: eine literalistische Kunst. Denn ähnlich wie die Objekte der Minimal-Künstler wollen auch Walters Ölbilder „in einer Situation erfahren (werden) – und zwar in einer, die geradezu den Betrachter mit umfasst“. Über die unmittelbare Wirkung, welche ihre Bilder auf unsere Wahrnehmung ausüben, sprach ich mit Friederike Walter in ihrem Frankfurter Atelier.
Hortense Pisano: Erst kürzlich haben wir uns in einer Ausstellung temporäre Behausungen angeschaut, die sich alle wohltuend vom Prinzip der üblichen vier feststehenden Wände abhoben. Räume, so hast du mir erzählt, haben dich stets fasziniert. Weshalb faszinieren dich ausgerechnet jene rein funktionalen, reduzierten Räume, wie etwa Fahrstühle, Schächte, Tiefgaragen, entleerte Zimmer und Raumfragmenten, die du malst?
Friederike Walter: Jeder Raum, der uns umgibt hat eine eigene Ausstrahlung – darauf achte ich und merke mir seine Beschaffenheit. Oft bewege ich mich auch in Gedanken durch Räume. Ich stelle mir vor, wie ich durch ein Haus gehe und mir dessen Zimmer ansehe. Ich suche diese imaginären Räumen und finde sie, um sie in Malerei umzusetzen.
Du sagtest gerade, du hättest dir angewöhnt, imaginäre Räume zu konstruieren, um durch sie hindurch zu gehen. Das klingt nach Anwendung der antiken Mnemotechnik. Eine Verbindung zwischen einem erdachten Raum und einer Textstruktur hätte ich bei dir nicht automatisch hergestellt, aber jetzt, wo wir darüber reden, macht es Sinn.
F. W.: Zwischen der Mnemotechnik und meiner Aufforderung, sich in Gedanken durch Räume zu bewegen, gibt es gewisse Überschneidungen – auch in meinen Arbeiten geht es ja um das Abrufen von Erinnerungen. Vor allem möchte ich aber die Neugier des Betrachters wecken, damit er anfängt, darüber nachzudenken, welchen Bildraum er gerade in Gedanken betritt. Wie sind die Größenverhältnisse zwischen ihm und dem Raum usw.? Mich selbst haben frühzeitig ähnliche Fragen beschäftigt. Zuerst begann ich, Jahreskalender als Grundlage für die von mir gestalteten Räume zu nutzen. In die Buchseiten hinein habe ich Durchbrüche erzeugt, Türen, Fenster und Schlitze in die mit Notizen gefüllten Seiten geschnitten, wodurch der Eintrag bzw. die Zeichnung vom Vortag sichtbar wurde. Raum wurde für mich damals als ein Zeitabschnitt erfahrbar.
Beim Anblick deiner Bilder kam mir Gaston Bachelards Äußerung in den Sinn, das Haus sei unser Winkel der Welt. Die Intimität des Hauses gewährt dem Träumer nach Bachelards Vorstellung Schutz. Doch je besser verräumlicht unsere Erinnerungen sind, desto feststehender, zeitloser werden sie. In welcher Konstellation stehen Raum, Zeit und Erinnerung in deinen Bildern?
F. W.: Räume, so habe ich anhand meiner autobiografisch angelehnten Jahreskalender zu erklären versucht, sind für mich täglich aufeinander folgende Zeitabschnitte. Zeiträume, die ich mir anschaue und in denen ich verweilen kann. Vor allem meine Serie „Raumlichte“ entstand mit dem Ziel, ähnliche Raum-Zeit-Fragen beim Betrachter auszulösen. Ausgehend von der Frage: In welchem Raum befinde ich mich gegenwärtig und welchen Erinnerungsraum denke ich zugleich mit? Bis hin zur Frage: Wohin käme ich, würde ich diesen Raum in eine Zukunft erweitern?
„Wir sind umgezogen“ lautet der Titel einer deiner Bilder, der wie ein Zuruf klingt. Dieses Bild entfaltet seinen poetischen Reiz durch minimal gesetzte Akzente – etwa jene auf Wand und Boden sich ergießenden Lichtreflexe oder durch die wenigen im Raum verbliebenen Möbel. Woher stammte die Idee zu diesem die Phantasie anregenden Motiv?
F. W.: Ich habe das Zimmer mit den vier auf dem Tisch stehenden Stühlen in Wien entdeckt, in einem leer stehenden Laden.
Konntest du den Laden betreten?
F. W.: Nein, ich musste die Situation durch die Fensterscheibe hindurch fotografieren. Das ursprüngliche Motiv habe ich darauf leicht verändert. Tisch und Stühle sind geblieben. Mir gefiel an diesem Arrangement, dass es offen bleibt, ob hier gerade etwas beendet wurde oder schon etwas Neues beginnt. Ich mag diese Ambivalenz in Bildern. Bei meinem Bild Aufzug „6. Stock“ ist das ähnlich, hier weiß der Betrachter auch nicht genau, ob er vor oder im Inneren des Aufzugs steht. Es könnte beides sein…
Beim Betrachten jenes besagten leeren Zimmers ist mir der Gedanke gekommen, es handele sich hier um dein eigenes. Tatsächlich bietet deine Serie der „Räume“ uns noch die Möglichkeit, Restspuren von Privatheit zu entdecken. „Raumlichte“ und „Ansichten“ sind beides Serien, die du 2007 und damit später begonnen hast. Die Räume wirken aufgrund ihrer spärlichen Informationen noch rätselhafter, sind verschachtelt. Weshalb?
F. W.: Den Eindruck von in sich verschachtelten Räumen habe ich bei meinen später gemalten Bildern noch zu verstärken versucht. Das geht soweit, dass man bei den „Betrachtungen von allen Seiten“ nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, die Orientierung im Raum also maßgeblich erschwert wird.
Auf die Idee zu dieser Bildserie kam ich erstmals 2013 in Budapest. Damals begann ich aufgrund eines Reisestipendiums mit kleineren Formaten zu arbeiten. Als ich dann an einem Morgen zurück ins Atelier kam, stand mein gerade begonnenes Bild auf dem Kopf. Für mich hat sich da wie ein Hebel umgelegt. Plötzlich war mir bewusst, dass bei jeder Drehung des Bildes ein anderer Raum zu Tage tritt. Ich begann darauf, eine Serie an Räumen zu malen, die ein und dasselbe Motiv aus vier verschiedenen Richtungen zeigt. Das Motiv ist im bzw. gegen den Uhrzeiger gedreht. Der Betrachter soll diesen Perspektivwechsel gleichfalls nachvollziehen können.
Apropos Multiperspektive, hat dich Caspar David Friedrichs Zeichnungen „Blick aus dem Atelier“ eigentlich auf eine Art inspiriert? Ich meine jenes karg gezeichnete Zimmer, von dem aus der Blick durch ein Fenster hinaus auf die Elbe gelenkt wird. Vor allem, weil Friedrich sein Atelier einmal aus der Perspektive des linken und ein zweites Mal aus der Perspektive des rechten Auges festgehalten hat, das Sehen als Vorgang thematisiert, ähnlich wie das auch bei dir der Fall ist.
F. W.: Ja sicher, ich kenne die Zeichnung. Inspiriert direkt hat sie mich nicht, aber du hast Recht, da besteht eine starke Verbindung. Gerade in meinen aktuellsten Arbeiten, geht es um das binokulare Sehen. Ein und dasselbe Motiv kann, wenn es gedreht wird, eine vollkommen neue Raumwahrnehmung erzeugen.
Während Friedrich um das Jahr 1805 die Natur und mit ihr die Wirklichkeit als etwas spiegelt, das sich außerhalb seiner inneren Gedankenwelt befindet, führt auf deinen Bildern augenscheinlich kein Weg mehr nach draußen. Beginnend mit den „Räumen“ als auch bei den Serien „Raumlichte“, den „Ansichten“ und „Betrachtungen“ bleibt die Sicht ins Freie versperrt, wodurch der Eindruck eines Labyrinths entsteht.
F. W.: Die Suche nach Klarheit ist bei all meinen Bildern grundlegend. Ich finde diese Klarheit in der Fläche. Daher denke ich eher an einen Maler wie Josef Albers, die Art und Weise, wie er Flächen und Farben auf die Leinwand gesetzt hat. Sowohl die Farbfeldmalerei als auch die abstrakte Kunst sind beide für meine eigene Malweise wichtig. Ich würde das Augenmerk daher weniger auf das Fehlen von Natur lenken wollen als viel mehr auf die Art, wie durch das Schichten von Flächen und Farbe Raum und Tiefe auf den Bildern erzeugt wird. – Was du als labyrinthisch empfinden magst, ist der Versuch, den Betrachter vor Entscheidungsfragen zu stellen: Wohin zieht es mich, ins Helle oder Dunkle, will ich lieber nach rechts oder links?
Aber es stimmt schon, meine Bilder schreien dich nicht an – aufgrund ihrer reduzierten Formen und Farbgebung. Sie brauchen eindeutig Zeit, bis sie anfangen, ihre Fragen zu stellen. Das Erzeugen von Stille spielt dabei eine große Rolle.
Deine Bilder beginnen sogar erstaunlich schnell zu sprechen, und zwar sobald wir direkt vor ihnen stehen. Deine aus geometrischen Linien und Flächen aufgebauten Räume wollen dabei mal mit Abstand, mal aus der Nähe oder von rechts und links angeschaut werden. Du willst mit anderen Worten, dass wir unseren festen Standort verlassen, uns vor dem Bild bewegen. In dem Moment, in dem wir uns auf dieses Spiel mit den wechselnden Standpunkten einlassen, erkennen wir auf deinen Bildern einen faszinierenden Wandel an Farben und ein Wechsel auf der Oberflächenstruktur.
F. W.: Meine Bilder bestehen aus mehreren Schichten unterschiedlicher Ölfarben, die ich im Laufe von drei Monaten übereinander auf die Leinwand schichte. Oft arbeite ich an mehreren Bildern gleichzeitig, weil sie aus derart vielen Farbschichten bestehen.
Jeder Zentimeter Bild ist gefüllt mit Farbe und je nach Lichteinfall kommt eine andere Farbschicht zum Vorschein. Wärmeres Licht bringt die Rottöne besser heraus und entsprechend verhält es sich mit bläulichem Licht. Das mag selbstverständlich klingen, tatsächlich hat der Lichteinfluss aber einen enormen Einfluss auf meine Bilder, insbesondere dort, wo ich Licht darstelle. Ein Weiß besteht bei mir beispielsweise aus einem Hellgelb, -rosa, -blau, eigentlich aus einer Schichtung aller Spektralfarben und diese bringen das Bild schließlich zum Leuchten.
Genauso wichtig ist die Nah- und Fernwirkung der Farben – je näher ich an ein Bild herantrete, desto mehr Farben vermag ich als Betrachter zu entdecken. Von weitem siehst du das Weiß eher als opake Fläche.
Es geht mit anderen Worten um die Substanz moderner Malerei – um das Erschaffen von Farbräumen, welche die dreidimensionierte Guckkastenbühne aufheben.
F. W.: Ja, so ist es. Mir ist es ganz wichtig, dass jeder Zentimeter Leinwand eine Magie von Farben erzeugt. Deshalb arbeite ich nur mit Tageslicht, damit die feinen Farbnuancen besser zur Geltung kommen.
…und im Winter?
F. W.: …entstehen vornehmlich meine Skizzen – Öl auf Papier.
Lass uns abschließend über deine neueren Arbeiten sprechen: Farbe geht jetzt zunehmend in Form und Fläche über. Der „vorgefundene Raum“ wird hier noch spärlicher angedeutet. Mehr als je zuvor scheinen diese Bilder uns mit der Frage konfrontieren zu wollen, wo beginnt die Realität und wo die Fiktion?
F. W.: Das Dargestellte scheint auf den ersten Blick real sein zu können, jedoch bei näherer Betrachtung des Raumes löst er sich immer weiter auf, da die Markierungen mehr und mehr fehlen. In den neueren Bildern geht es um Räume, die leer bleiben müssen, nicht mit Mobiliar gefüllt werden können, weil sie jenes Moment in sich tragen sollen, des Gefundenen, gerade erst im Kopf entstandenen Raumes. Ähnlich wie im Traum, wo man eine Tür aufmacht und einen Raum entdeckt, den man vorher noch nie gesehen hat. Deshalb wirken die Räume derart unberührt.
[1] Michael Fried: Kunst und Objekthaftigkeit, in: „Minimal Art“, Hrsg. Gregor Stemmrich, Dresden/ Basel 1995, S. 342.
Red. Anm.: In einer leicht veränderten Fassung ist das folgende Interview für das „Darmstädter Kalenderblatt 2016“ erschienen. Foto: Friederike Walter (http://www.friederikewalter.de)
